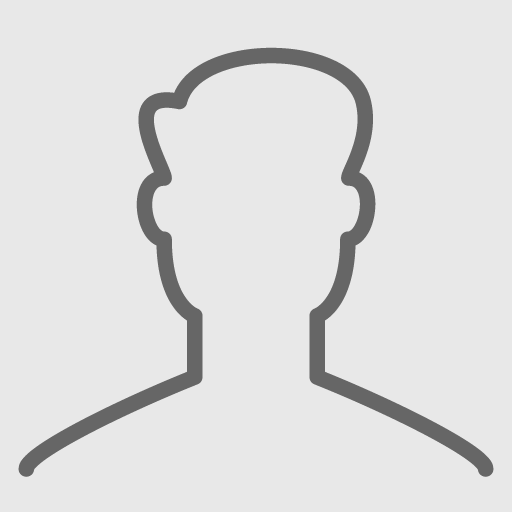Changetagung – Verlässliche Kooperation in Zeiten der Digitalisierung
Themenauswahl & Farblegende :
Themen
Es werden alle Themen angezeigt.
Präsentationsarten
Präsentationsarten
Alle Arten werden angezeigt.
Changetagung – Verlässliche Kooperation in Zeiten der Digitalisierung
Freitag – 28.01.2022
09:00
09:45
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00